
Beitragsreihe zum Handbuch «Das politische System Liechtensteins»
Viele Jahrzehnte dominierten zwei Parteien die Politik in Liechtenstein: die Fortschrittliche Bürgerpartei und die Vaterländische Union. Doch seit den 1980er-Jahren weitet sich das Parteienspektrum aus.
Text: Wilfried Marxer
In Liechtenstein wurden die ersten beiden Parteien erst 1918 gegründet: die Christlich-soziale Volkspartei (VP) und die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP). Diese lieferten sich in den 1920er- und 1930er-Jahren heftige Parteienkämpfe. Zunächst dominierte die von Wilhelm Beck gegründete Volkspartei, aber der Sparkassaskandal 1928 leitete die Vorherrschaft der FBP bis Ende der 1960er-Jahre ein.
1930er-Jahre und Zweiter Weltkrieg
In den 1930er-Jahren wurde der Liechtensteiner Heimatdienst aktiv. Dieser fusionierte 1936 mit der Volkspartei zur Vaterländischen Union (VU). In dieser Zeit wurde auch das Proporzwahlrecht eingeführt. 1939 fanden jedoch sogenannte stille Wahlen ohne Urnengang statt. FBP und VU hatten sich auf eine proportionale Vertretung im Landtag mit acht FBP- und sieben VU-Mandaten geeinigt. Mit der stillen Wahl wurde der nationalsozialistisch orientierten Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein (VDBL) der Einzug in den Landtag verwehrt – wobei zusätzlich eine 18-Prozent-Sperrklausel ins Wahlrecht aufgenommen worden war. 1943 verlängerte der Fürst die Mandatszeit, sodass erst 1945 wieder Landtagswahlen stattfanden.
1950er- bis 1970er-Jahre
1953 kandidierte eine dritte Partei, die «Liste der Unselbständig Erwerbenden und Kleinbauern», erfolglos zum Landtag, erreichte aber immerhin 6,9 Prozent der Stimmen. Grösseren Zuspruch erhielt die Christlich-soziale Partei (CSP) 1962. Mit 10,1 Prozent der Stimmen scheiterte sie aber an der Sperrklausel von 18 Prozent, die später vom Staatsgerichtshof aufgehoben wurde. Bei den folgenden Wahlen 1966, 1970 und letztmals 1974 schnitt die CSP immer schwächer ab.
1970 kam es zu einer Umkehr der Mehrheitsverhältnisse: die VU konnte acht Mandate gegenüber sieben Mandaten der FBP erringen und somit auch den Regierungschef und die Mehrheit in der Regierung stellen, nachdem bis dahin die Regierungskoalition unter Führung der FBP gestanden hatte. Doch schon 1974 kehrten die Mehrheitsverhältnisse wieder, ebenso 1978 – dies leitete eine lange VU-Mehrheit ein, die unter Regierungschef Hans Brunhart bis 1993 dauerte.
1980er- bis 2000er-Jahre
Nach dem Ende der CSP dauerte es zwölf Jahre, bis mit der Freien Liste (FL) wieder eine dritte Partei neben VU und FBP zu Landtagswahlen antrat. Sie scheiterte 1986 und bei den vorgezogenen Neuwahlen 1989 jeweils knapp an der 1970 eingeführten 8-Prozent-Sperrklausel. 1989 nahm erstmals eine vierte Partei an Landtagswahlen teil. Die Überparteiliche Liste Liechtenstein (UeLL) schnitt mit 3,2 Prozent eher schwach ab und kandidierte kein weiteres Mal. 1993 schaffte die FL im dritten Anlauf den Einzug in den Landtag, es blieb aber weiterhin bei einer klaren Dominanz der beiden Traditionsparteien. Die grosse Koalition wurde nun unter FBP-Führung (Markus Büchel) fortgesetzt, nach dessen Abwahl im gleichen Jahr folgte ab Herbst 1993 die Koalition unter VU-Führung (Mario Frick).
1997 begab sich die FBP nach dem erneuten Wahlsieg der VU in die Opposition und es kam zu einer Alleinregierung der VU, vier Jahre später zu einer Alleinregierung der FBP unter Otmar Hasler. 2005 konnte er die zweite Mandatsperiode als Regierungschef antreten, die schwächere VU begab sich als Juniorpartner wieder in die Regierung. 2009 kehrten die Mehrheitsverhältnisse erneut und Klaus Tschütscher führte eine VU-FBP-Koalition an. Die FL konnte bei allen Wahlen ab 1993 mit wenigen Mandaten den Einsitz im Landtag bestätigen.
2010er-Jahre bis in die Gegenwart
Bei den Wahlen 2013 trat erstmals seit 1989 wieder eine vierte Partei zu den Landtagswahlen an: DU – Die Unabhängigen. Der Gründung der Partei war der Austritt des Abgeordneten Harry Quaderer aus der VU-Fraktion vorausgegangen. Sie erreichte 2013 vier von 25 Mandaten, 2017 sogar fünf. Bis zu den nächsten Landtagswahlen 2021 spaltete sich DU, sodass nun erstmals fünf Parteien antraten: FBP, VU, FL, DU und DpL (Demokraten pro Liechtenstein). DpL schnitt mit 11,1 Prozent der Stimmen und zwei Mandaten deutlich besser ab als DU mit 4,2 Prozent und keinem Mandat. 2013 bis 2021 wurde eine FBP-VU-Koalition von Adrian Hasler angeführt.
Zwischen VU und FBP ergab sich 2021 erstmals ein Mandatspatt mit je zehn Sitzen, die FL erreichte drei Mandate, DpL zwei. Daniel Risch wurde Regierungschef in der VU-FBP-Koalition. 2025 trat DU nicht mehr an. DpL konnte stark zulegen und kam auf sechs Mandate, die VU konnte ihre zehn Mandate verteidigen, die FBP sank dagegen auf sieben, die FL auf zwei Mandate. Die VU-FBP-Koalition unter der erstmaligen Führung einer Frau, Brigitte Haas, wurde fortgesetzt.
Nach den Wahlen 2021 hatte sich noch eine weitere Partei ins Spiel gebracht: Mensch im Mittelpunkt (MiM). Trotz Ankündigung trat diese Partei jedoch weder bei den Gemeindewahlen 2023 noch bei den Landtagswahlen 2025 an.
Das politische System Liechtensteins
Das Handbuch enthält in 23 Kapiteln Informationen zu Themen wie Souveränität, Regierung, Landtag, Parteien, Medien, Wahlen und Wahlsystem, Politische Kultur u. v. a.
Die Print-Ausgabe ist im Buchhandel erhältlich. Das ePDF kann kostenlos von der Website des Liechtenstein-Instituts oder des Nomos-Verlags heruntergeladen werden.
_____________________________________________________________________
Heute zum Thema: «Parteien»
Der Beitrag zu den Parteien von Wilfried Marxer im Handbuch «Das politische
System Liechtensteins» gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Parteiwesens, die rechtlichen Grundlagen, Parteienprofile, Parteienfinanzierung,
Parteimedien u.a. Abgerundet wird der Beitrag durch einen internationalen Vergleich, eine umfangreiche Literaturliste und Internetlinks zu relevanten Websites.
Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen Autoren.




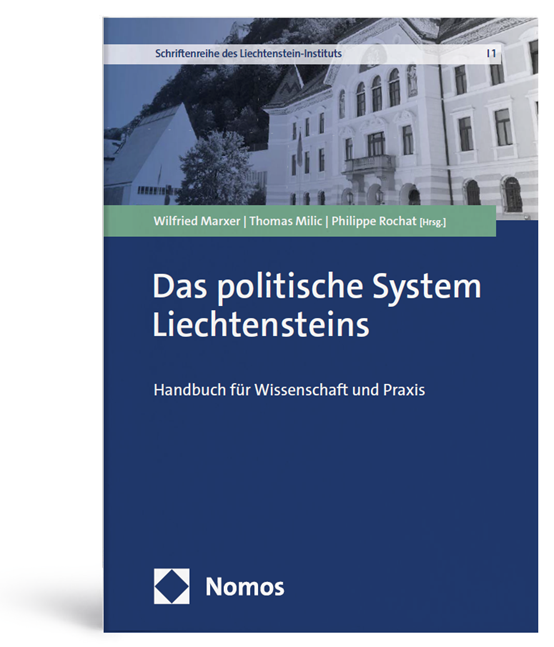






Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.